
@ Michael Meyen
2025-02-11 10:52:56
Die Sehnsucht gar nicht so weniger Westdeutscher ist groß – besonders dann, wenn sie schon etwas älter sind und sich zu fragen beginnen, was bisher gefehlt hat in ihrem Leben. Die Antwort kann man zum Beispiel im *Kontrafunk* hören: „Plötzlich bewegt sich was“ stand dort über der letzten [Sonntagsrunde](https://kontrafunk.radio/de/sendung-nachhoeren/politik-und-zeitgeschehen/die-sonntagsrunde/die-sonntagsrunde-mit-burkhard-mueller-ullrich-ploetzlich-bewegt-sich-was#id-article). Eine Revolution, vielleicht doch noch. 1848, 1919, WIR. Und 1989, okay. Man muss nur ein wenig Markus Vahlefeld lauschen, Prototyp des konservativen Intellektuellen, knapp 60 inzwischen, um zu verstehen, wie tief dieser Stachel sitzt. Die im Osten – die haben uns etwas voraus. Die waren mittendrin, als sich die Welt zu drehen begann. Lasst uns also alles dafür tun, damit das nicht so bleibt bis in alle Ewigkeit.
Wer zu den Wurzeln dieser Sehnsucht will, sollte die beiden Bücher lesen, die ich in dieser Kolumne schon einmal [empfohlen](https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/die-afd-spricht-englisch) habe und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Klein, eher dünn und sehr persönlich das eine, wuchtig, sachlich-kühl und mit dem Zeug zum großen Wurf das andere. Autobiografie hier, Wissenschaft dort – jeweils nicht zu verstehen ohne das, was Markus Vahlefeld und seine Leidensgenossen so schmerzlich vermissen. Die Erfahrung, dass morgen alles anders sein kann, lässt den Menschen gelassen und den Gedanken an mögliche Verluste beim Schreiben kleiner werden.
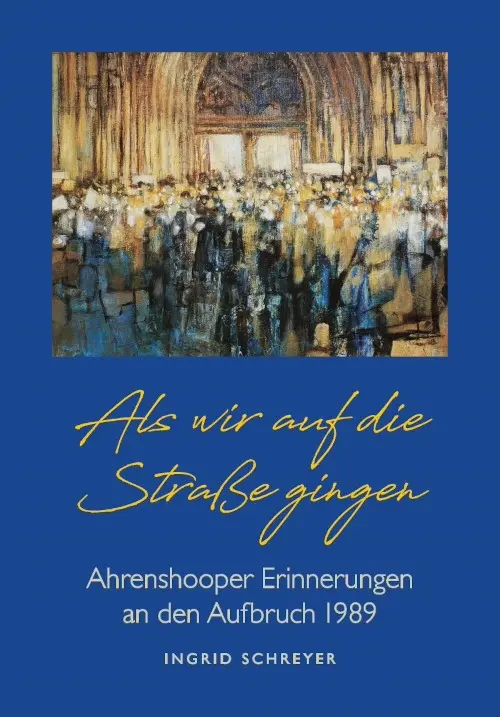
[Ingrid Schreyer](https://ingrid-schreyer.de/) hat angefangen, ihre Erinnerungen festzuhalten. Auf dem Cover geht es vordergründig um „den Aufbruch 1989“ und um Ahrenshoop, einen feinen Badeort an der Ostsee, in dem Büchlein steckt aber viel mehr – und das nicht nur, weil die Autorin mit Wolfgang Schreyer verheiratet war, einem Schriftsteller mit Millionenpublikum, deutlich älter als sie und auf der Höhe seines Schaffens auch attraktiv für eine Frau wie Brigitte Reimann, wie man in einem wunderbaren [Briefwechsel](http://okapi-verlag.de/2018/06/08/60-121/) nachlesen kann. Wolfgang, dieser Erfolgsmensch, ist natürlich noch präsent im Gedächtnis von Ingrid Schreyer. Die gemeinsamen Bücher in den 1980ern und eine Lesung in Leipzig, die Gespräche mit Stefan Heym in Strandnähe und der 9. November 1989, als Ingrid, gerade 45, unbedingt nach Berlin will, aber weder ihren Mann noch Sohn Paul, damals erst 12 und inzwischen Mitherausgeber von *Multipolar*, überzeugen kann. Das Ende der Mauer vor dem Fernsehapparat und nicht dort, wo gerade ein Weltreich zusammenbricht. So viel Rotwein steht in keinem Keller.
„Wie wir auf die Straße gingen“: Dieser Titel spielt zunächst auf das an, was da hoch im Norden des Landes passiert ist, fernab der Metropolen, über die heute jeder Geschichtslehrer spricht. Der 9. Oktober in Leipzig, der 4. November in Berlin. Wie war das in Ribnitz-Damgarten und in Ahrenshoop? Wie ist Ingrid Schreyer dazu gekommen, in einem Dorf hunderte Unterschriften für das Neue Forum zu sammeln, dann eine Ortsgruppe zu gründen und die Gästehäuser der Stasi zu enttarnen? Die Antworten führen in ein christliches Elternhaus in Magdeburg, zu einem Urgroßvater, der in der Stadt als Uhrmacher und Optiker genauso eine Nummer wurde wie 1848 in der Opposition, und in ein Milieu, für das die DDR so selbstverständlich war, dass man sich nicht viel dabei dachte, kurz nach Ulbrichts Kahlschlag von 1965 einen Klub mit dem Namen „Die Andersdenkenden“ zu gründen und dort mit Beat und Joints über Gott und die Welt zu streiten, ganz ohne Angst vor Spitzeln. Auch diese Autobiografie lebt ein wenig von den Namen, die Ingrid Schreyer immer wieder einstreut, sie erzählt aber zugleich eine ganz eigene DDR-Geschichte, die, so verspricht es der Buchrücken, fortgesetzt werden soll. Den ersten Band der „Ahrenshooper Erinnerungen“ gibt es genau wie Ingrid Schreyers Bücher über die Kunst in Ahrenshoop nur bei ihr selbst, zu ordern über die [Webseite](https://ingrid-schreyer.de/bucher/).
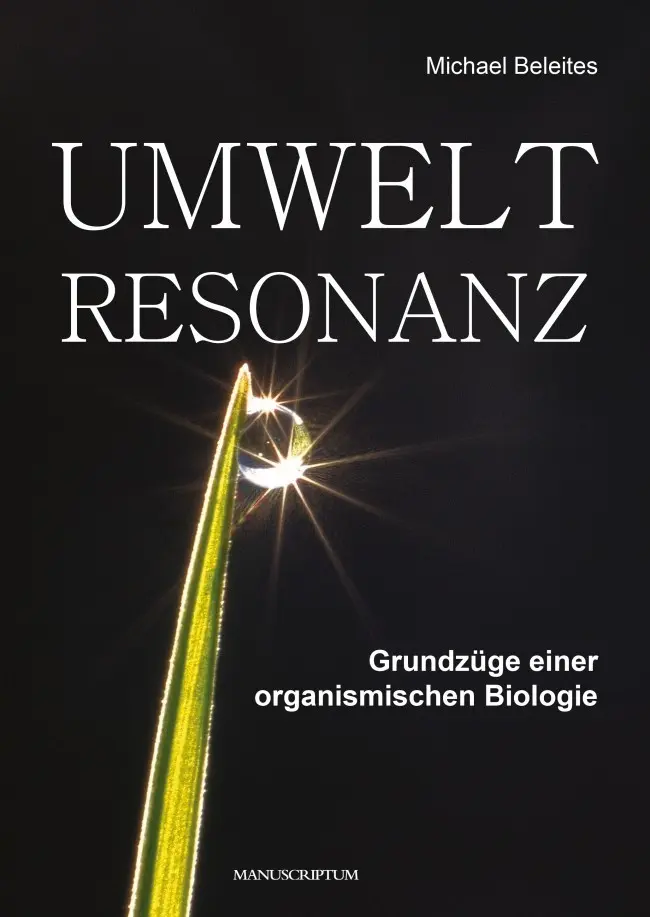
Das Buch von [Michael Beleites](http://www.michael-beleites.de/) hat schon einen Verlagswechsel hinter sich und ist trotzdem noch nicht wirklich angekommen in der Öffentlichkeit. Man könnte sagen: ein dicker Brocken, okay. Wer liest schon knapp 700 Seiten, wenn Titel und Untertitel eher schwere Kost versprechen? Das ist hier aber nicht der Punkt. Dieses Buch hat das Zeug, erst Klarheit in den Köpfen zu schaffen und dann die Welt zu verändern. Eine Revolution – aber ganz anders, als sich das die Sonntagsrunde im *Kontrafunk* gerade ausgemalt hat. Michael Beleites rüttelt an den Grundfesten unseres Denkens. Charles Darwin. Kleiner wird es nicht. Die Selektionshypothese, sagt Michael Beleites, ist widerlegt und damit alles, was mit dem Motto „Survival of the Fittest“ über uns gekommen ist. Der ewige Kampf ums Dasein. Das Wettrennen der Egoisten und damit Kapitalismus. Eine „Machbarkeits-Ideologie“, die glaubt, die Natur „zum Wohle des Menschen“ manipulieren zu können, und so Pate stand bei den Völkermorden der Nationalsozialisten. Neben Darwin räumt dieser Michael Beleites auch die Lehre von der „Vererbung erworbener Eigenschaften“ ab, einen Gegenspieler der Selektionstheorie, und damit den „biologistischen Unterbau“ der „sowjet-kommunistischen Stalin-Diktatur“, die auf „Züchtung durch Erziehung“ gesetzt habe (S. 583). Der lange Atem des Darwinismus reicht dabei weit über die Politik hinaus – von einem Artenschutz, der nicht verstehen will, dass der Lebensraum zur Art gehört, über die „Illusion“ Permakultur (S. 518) bis zum Ausblenden der „geographischen Rassenvielfalt“ als „biologische Tatsache“ und „unschätzbares Naturerbe der Menschheit“ (S. 530).
Ich gebe zu: Das ist viel auf einmal. So viel und so grundlegend, dass es fast schon verwunderlich wäre, wenn der Autor keine Angriffe erlebt hätte. Ich bin auf Michael Beleites in einem Buch von [Claus M. Wolfschlag](https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/202997/meinung-pranger-konsequenzen?number=9783949041143) gestoßen. Eine Sammlung von zwei Dutzend Prangergeschichten, die ich im Sommer 2024 eigentlich rezensieren wollte, weil sie das auf sehr persönliche Weise ergänzen, was ich gerade selbst eher abstrakt als [Cancel Culture](https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/cancel-culture-zum-horen) beschrieben hatte. Im Garten schien die Sonne, aber mir war trotzdem zum Heulen. Keine Spur von Schreiblust. Das Beleites-Interview setzte allem die Krone auf. Da sprach ein Mann, dessen Namen ich aus der Geschichte des Umbruchs kannte, als Stasi-Opfer und als sächsischen Beauftragten für das Erbe des DDR-Geheimdienstes, über die ungeheuerlichen Dinge, die ihm in der Bundesrepublik der 2010er Jahre widerfahren waren, weil er mit den falschen Leuten gesprochen hat. Weil er prinzipiell mit allen redet. Weil die falschen Leute seine Ideen spannend fanden. Weil diese Ideen an der falschen Stelle erschienen waren. Pegida, Höcke, Schnellroda. Ich kann diese Rufmordgeschichte hier nur andeuten, weiß aber noch, wie ich in meinem Lesestuhl förmlich erdrückt worden bin von der Lawine, die da über Michael Beleites hereingebrochen ist. Ausladungen. Die üblichen Schlagworte: Rassismus, Antisemitismus, Nazi. Eine [Attacke](https://www.spiegel.de/spiegel/warum-ddr-buergerrechtler-sich-bei-der-afd-engagieren-a-1186288.html) im *Spiegel*. Boykott der Blumen und Kräuter, die Beleites und seine Frau in ihrem Gartenbetrieb wachsen lassen. Antifa-Attacken auf den Wochenmarktstand in der Dresdner Neustadt. Keine Chance mehr für ihre Kräutertees in den Bioläden der Stadt. In einem Wort: Existenzvernichtung wegen eines Gesinnungsverdachts, ohne dass jemand hören wollte, was dieser Autor eigentlich zu sagen hat und wie er darauf kommt.
Michael Beleites ist ein Kind vom Land. Er hat schon als kleiner Junge Vögel fotografiert – an der Abbruchkante eines stillgelegten Braunkohletagebaus. Er schwärmt am Ende seines Buches von den Menschen, die ihm geholfen haben, Vogelstimmen zu unterscheiden und zu spüren, wie sich Landschaft und Tierwelt bedingen. Wie Ingrid Schreyer wächst Michael Beleites in einem christlichen Umfeld auf. Der Sohn eines evangelischen Pfarrers darf zwar kein Abitur machen und damit auch nicht Biologie studieren, wird aber Präparator, arbeitet erst in einem Naturkundemuseum und dann freiberuflich. Wir sind immer noch in der DDR, wo Beleites 1988 eine Dokumentation über den Uranbergbau veröffentlicht – seine Eintrittskarte in die Politik der dann plötzlich vergrößerten Bundesrepublik, die ihn zwar ebenfalls nicht Biologie studieren lässt, aber seinen Göttern näherbringt – Otto Kleinschmidt vor allem, einem Ornithologen, der im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein „revolutionäres Konzept zur biologischen Variation“ entwickelt, aber weitgehend vergessen wird, weil er „der allgemein anerkannten Lehrmeinung“ widerspricht (S. 15). Darwin und sonst nichts, damals schon.
Wer bis hierher durchgehalten hat, versteht hoffentlich meine Bewunderung für ein Werk, das jenseits der üblichen akademischen Pfade und ohne die Sicherheit gewachsen ist, die eine Position in Universitäten oder Forschungsinstituten bietet, und trotzdem ganz genau weiß, mit was und mit wem es sich da anlegt. Michael Beleites kennt Literatur und Gegenargumente. Auch deshalb kann er es nicht unter 700 Seiten machen. Vor allem aber kennt dieser Autor seinen Gegenstand. Michael Beleites hat tausendfach gesehen, dass es in der Natur nicht um Konkurrenz geht, sondern um Zusammenhalt und Harmonie. Er sagt: Die Natur züchtet nicht. Wenn sich Arten verändern, dann im Ganzen. Anders formuliert: Die Merkmale verschieben sich zeitgleich, weil die Dinge zusammenhängen und Kräften unterliegen, die wir zwar benennen, aber schlecht messen oder gar im Experiment nachweisen können. Umweltresonanz (der Begriff, der auf dem Cover steht und zugleich Programm ist für eine nachmaterialistische Naturwissenschaft) steht bei ihm auch für den Zugriff auf die Art-„Programme“, die Gestalt und Verhalten steuern (S. 437), sowie auf die „jeweils verfügbaren natürlichen Umweltinformationen“ (S. 438). Magnetfelder, Himmelslicht und Sterne – sicht- und spürbar in der „freien Natur“, aber nicht oder allenfalls eingeschränkt im „urbanen Raum“.
Michael Beleites unterfüttert das immer wieder mit Beobachtungen und Bildern – Lesegenuss und Augenschmaus in einem. Vor allem aber belässt er es nicht bei der Kritik, sondern bietet Lösungen, die weit über das hinausgehen, was im Moment in der Gegenöffentlichkeit diskutiert wird, weil sich seine Vorschläge schlüssig aus einem großen Theoriegebäude ableiten lassen. Ich kann das hier nur mit Schlagworten andeuten. Raus aus der Stadt. Wenn das nicht auf Dauer geht, dann wenigstens so oft wie möglich. Zurück zur bäuerlichen Landwirtschaft, zurück zu dem, was den Menschen ausmacht. Körperlich arbeiten in der Natur. Heimat statt Bodenlosigkeit und damit eher Dorf als Flugzeug. Der Mensch, sagt Michael Beleites, ist gar nicht so viel anders als Tiere oder Pflanzen. Jedes Individuum spürt eine „Neigung“, im Einklang mit dem zu sein, was für die Spezies bereits da ist (S. 592). Sein Buch kündet davon, dass Michael Beleites so lebt, wie es zu ihm passt. Dann können einem irgendwelche Krakeeler auch nicht viel anhaben.
*Titelbild*: Leipzig, 23. Oktober 1989. Bundesarchiv, Bild 183-1989-1023-022, Friedrich Gahlbeck (ADN)
[Freie Akademie für Medien & Journalismus](https://www.freie-medienakademie.de/)
[Unterstützen](https://www.freie-medienakademie.de/unterstuetzen)
 @ Michael Meyen
2025-02-11 10:52:56Die Sehnsucht gar nicht so weniger Westdeutscher ist groß – besonders dann, wenn sie schon etwas älter sind und sich zu fragen beginnen, was bisher gefehlt hat in ihrem Leben. Die Antwort kann man zum Beispiel im *Kontrafunk* hören: „Plötzlich bewegt sich was“ stand dort über der letzten [Sonntagsrunde](https://kontrafunk.radio/de/sendung-nachhoeren/politik-und-zeitgeschehen/die-sonntagsrunde/die-sonntagsrunde-mit-burkhard-mueller-ullrich-ploetzlich-bewegt-sich-was#id-article). Eine Revolution, vielleicht doch noch. 1848, 1919, WIR. Und 1989, okay. Man muss nur ein wenig Markus Vahlefeld lauschen, Prototyp des konservativen Intellektuellen, knapp 60 inzwischen, um zu verstehen, wie tief dieser Stachel sitzt. Die im Osten – die haben uns etwas voraus. Die waren mittendrin, als sich die Welt zu drehen begann. Lasst uns also alles dafür tun, damit das nicht so bleibt bis in alle Ewigkeit. Wer zu den Wurzeln dieser Sehnsucht will, sollte die beiden Bücher lesen, die ich in dieser Kolumne schon einmal [empfohlen](https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/die-afd-spricht-englisch) habe und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Klein, eher dünn und sehr persönlich das eine, wuchtig, sachlich-kühl und mit dem Zeug zum großen Wurf das andere. Autobiografie hier, Wissenschaft dort – jeweils nicht zu verstehen ohne das, was Markus Vahlefeld und seine Leidensgenossen so schmerzlich vermissen. Die Erfahrung, dass morgen alles anders sein kann, lässt den Menschen gelassen und den Gedanken an mögliche Verluste beim Schreiben kleiner werden. 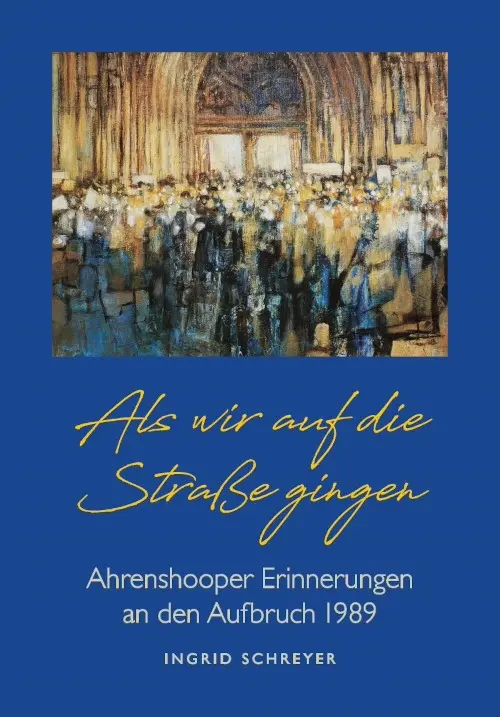 [Ingrid Schreyer](https://ingrid-schreyer.de/) hat angefangen, ihre Erinnerungen festzuhalten. Auf dem Cover geht es vordergründig um „den Aufbruch 1989“ und um Ahrenshoop, einen feinen Badeort an der Ostsee, in dem Büchlein steckt aber viel mehr – und das nicht nur, weil die Autorin mit Wolfgang Schreyer verheiratet war, einem Schriftsteller mit Millionenpublikum, deutlich älter als sie und auf der Höhe seines Schaffens auch attraktiv für eine Frau wie Brigitte Reimann, wie man in einem wunderbaren [Briefwechsel](http://okapi-verlag.de/2018/06/08/60-121/) nachlesen kann. Wolfgang, dieser Erfolgsmensch, ist natürlich noch präsent im Gedächtnis von Ingrid Schreyer. Die gemeinsamen Bücher in den 1980ern und eine Lesung in Leipzig, die Gespräche mit Stefan Heym in Strandnähe und der 9. November 1989, als Ingrid, gerade 45, unbedingt nach Berlin will, aber weder ihren Mann noch Sohn Paul, damals erst 12 und inzwischen Mitherausgeber von *Multipolar*, überzeugen kann. Das Ende der Mauer vor dem Fernsehapparat und nicht dort, wo gerade ein Weltreich zusammenbricht. So viel Rotwein steht in keinem Keller. „Wie wir auf die Straße gingen“: Dieser Titel spielt zunächst auf das an, was da hoch im Norden des Landes passiert ist, fernab der Metropolen, über die heute jeder Geschichtslehrer spricht. Der 9. Oktober in Leipzig, der 4. November in Berlin. Wie war das in Ribnitz-Damgarten und in Ahrenshoop? Wie ist Ingrid Schreyer dazu gekommen, in einem Dorf hunderte Unterschriften für das Neue Forum zu sammeln, dann eine Ortsgruppe zu gründen und die Gästehäuser der Stasi zu enttarnen? Die Antworten führen in ein christliches Elternhaus in Magdeburg, zu einem Urgroßvater, der in der Stadt als Uhrmacher und Optiker genauso eine Nummer wurde wie 1848 in der Opposition, und in ein Milieu, für das die DDR so selbstverständlich war, dass man sich nicht viel dabei dachte, kurz nach Ulbrichts Kahlschlag von 1965 einen Klub mit dem Namen „Die Andersdenkenden“ zu gründen und dort mit Beat und Joints über Gott und die Welt zu streiten, ganz ohne Angst vor Spitzeln. Auch diese Autobiografie lebt ein wenig von den Namen, die Ingrid Schreyer immer wieder einstreut, sie erzählt aber zugleich eine ganz eigene DDR-Geschichte, die, so verspricht es der Buchrücken, fortgesetzt werden soll. Den ersten Band der „Ahrenshooper Erinnerungen“ gibt es genau wie Ingrid Schreyers Bücher über die Kunst in Ahrenshoop nur bei ihr selbst, zu ordern über die [Webseite](https://ingrid-schreyer.de/bucher/). 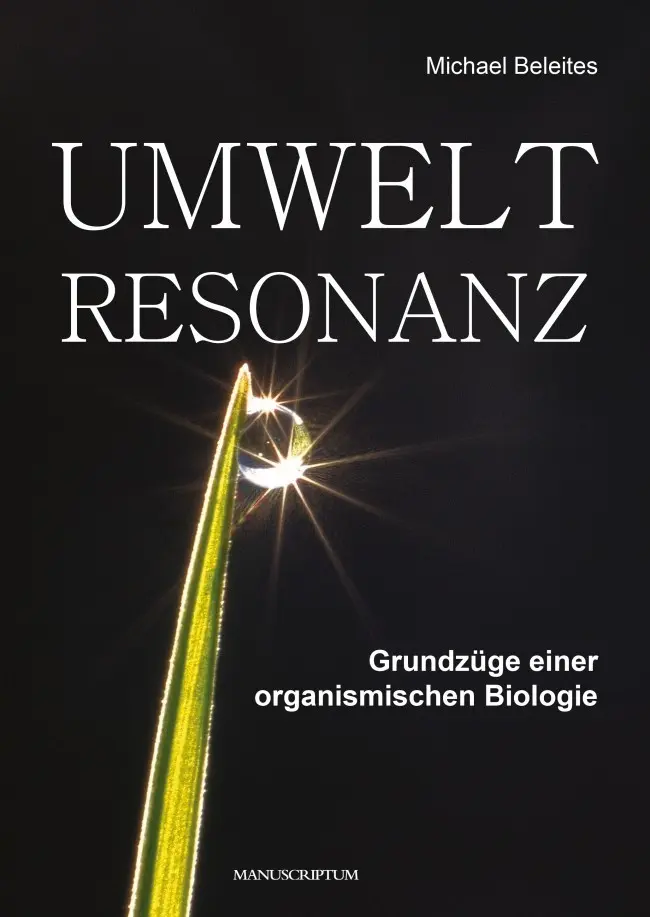 Das Buch von [Michael Beleites](http://www.michael-beleites.de/) hat schon einen Verlagswechsel hinter sich und ist trotzdem noch nicht wirklich angekommen in der Öffentlichkeit. Man könnte sagen: ein dicker Brocken, okay. Wer liest schon knapp 700 Seiten, wenn Titel und Untertitel eher schwere Kost versprechen? Das ist hier aber nicht der Punkt. Dieses Buch hat das Zeug, erst Klarheit in den Köpfen zu schaffen und dann die Welt zu verändern. Eine Revolution – aber ganz anders, als sich das die Sonntagsrunde im *Kontrafunk* gerade ausgemalt hat. Michael Beleites rüttelt an den Grundfesten unseres Denkens. Charles Darwin. Kleiner wird es nicht. Die Selektionshypothese, sagt Michael Beleites, ist widerlegt und damit alles, was mit dem Motto „Survival of the Fittest“ über uns gekommen ist. Der ewige Kampf ums Dasein. Das Wettrennen der Egoisten und damit Kapitalismus. Eine „Machbarkeits-Ideologie“, die glaubt, die Natur „zum Wohle des Menschen“ manipulieren zu können, und so Pate stand bei den Völkermorden der Nationalsozialisten. Neben Darwin räumt dieser Michael Beleites auch die Lehre von der „Vererbung erworbener Eigenschaften“ ab, einen Gegenspieler der Selektionstheorie, und damit den „biologistischen Unterbau“ der „sowjet-kommunistischen Stalin-Diktatur“, die auf „Züchtung durch Erziehung“ gesetzt habe (S. 583). Der lange Atem des Darwinismus reicht dabei weit über die Politik hinaus – von einem Artenschutz, der nicht verstehen will, dass der Lebensraum zur Art gehört, über die „Illusion“ Permakultur (S. 518) bis zum Ausblenden der „geographischen Rassenvielfalt“ als „biologische Tatsache“ und „unschätzbares Naturerbe der Menschheit“ (S. 530). Ich gebe zu: Das ist viel auf einmal. So viel und so grundlegend, dass es fast schon verwunderlich wäre, wenn der Autor keine Angriffe erlebt hätte. Ich bin auf Michael Beleites in einem Buch von [Claus M. Wolfschlag](https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/202997/meinung-pranger-konsequenzen?number=9783949041143) gestoßen. Eine Sammlung von zwei Dutzend Prangergeschichten, die ich im Sommer 2024 eigentlich rezensieren wollte, weil sie das auf sehr persönliche Weise ergänzen, was ich gerade selbst eher abstrakt als [Cancel Culture](https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/cancel-culture-zum-horen) beschrieben hatte. Im Garten schien die Sonne, aber mir war trotzdem zum Heulen. Keine Spur von Schreiblust. Das Beleites-Interview setzte allem die Krone auf. Da sprach ein Mann, dessen Namen ich aus der Geschichte des Umbruchs kannte, als Stasi-Opfer und als sächsischen Beauftragten für das Erbe des DDR-Geheimdienstes, über die ungeheuerlichen Dinge, die ihm in der Bundesrepublik der 2010er Jahre widerfahren waren, weil er mit den falschen Leuten gesprochen hat. Weil er prinzipiell mit allen redet. Weil die falschen Leute seine Ideen spannend fanden. Weil diese Ideen an der falschen Stelle erschienen waren. Pegida, Höcke, Schnellroda. Ich kann diese Rufmordgeschichte hier nur andeuten, weiß aber noch, wie ich in meinem Lesestuhl förmlich erdrückt worden bin von der Lawine, die da über Michael Beleites hereingebrochen ist. Ausladungen. Die üblichen Schlagworte: Rassismus, Antisemitismus, Nazi. Eine [Attacke](https://www.spiegel.de/spiegel/warum-ddr-buergerrechtler-sich-bei-der-afd-engagieren-a-1186288.html) im *Spiegel*. Boykott der Blumen und Kräuter, die Beleites und seine Frau in ihrem Gartenbetrieb wachsen lassen. Antifa-Attacken auf den Wochenmarktstand in der Dresdner Neustadt. Keine Chance mehr für ihre Kräutertees in den Bioläden der Stadt. In einem Wort: Existenzvernichtung wegen eines Gesinnungsverdachts, ohne dass jemand hören wollte, was dieser Autor eigentlich zu sagen hat und wie er darauf kommt. Michael Beleites ist ein Kind vom Land. Er hat schon als kleiner Junge Vögel fotografiert – an der Abbruchkante eines stillgelegten Braunkohletagebaus. Er schwärmt am Ende seines Buches von den Menschen, die ihm geholfen haben, Vogelstimmen zu unterscheiden und zu spüren, wie sich Landschaft und Tierwelt bedingen. Wie Ingrid Schreyer wächst Michael Beleites in einem christlichen Umfeld auf. Der Sohn eines evangelischen Pfarrers darf zwar kein Abitur machen und damit auch nicht Biologie studieren, wird aber Präparator, arbeitet erst in einem Naturkundemuseum und dann freiberuflich. Wir sind immer noch in der DDR, wo Beleites 1988 eine Dokumentation über den Uranbergbau veröffentlicht – seine Eintrittskarte in die Politik der dann plötzlich vergrößerten Bundesrepublik, die ihn zwar ebenfalls nicht Biologie studieren lässt, aber seinen Göttern näherbringt – Otto Kleinschmidt vor allem, einem Ornithologen, der im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein „revolutionäres Konzept zur biologischen Variation“ entwickelt, aber weitgehend vergessen wird, weil er „der allgemein anerkannten Lehrmeinung“ widerspricht (S. 15). Darwin und sonst nichts, damals schon. Wer bis hierher durchgehalten hat, versteht hoffentlich meine Bewunderung für ein Werk, das jenseits der üblichen akademischen Pfade und ohne die Sicherheit gewachsen ist, die eine Position in Universitäten oder Forschungsinstituten bietet, und trotzdem ganz genau weiß, mit was und mit wem es sich da anlegt. Michael Beleites kennt Literatur und Gegenargumente. Auch deshalb kann er es nicht unter 700 Seiten machen. Vor allem aber kennt dieser Autor seinen Gegenstand. Michael Beleites hat tausendfach gesehen, dass es in der Natur nicht um Konkurrenz geht, sondern um Zusammenhalt und Harmonie. Er sagt: Die Natur züchtet nicht. Wenn sich Arten verändern, dann im Ganzen. Anders formuliert: Die Merkmale verschieben sich zeitgleich, weil die Dinge zusammenhängen und Kräften unterliegen, die wir zwar benennen, aber schlecht messen oder gar im Experiment nachweisen können. Umweltresonanz (der Begriff, der auf dem Cover steht und zugleich Programm ist für eine nachmaterialistische Naturwissenschaft) steht bei ihm auch für den Zugriff auf die Art-„Programme“, die Gestalt und Verhalten steuern (S. 437), sowie auf die „jeweils verfügbaren natürlichen Umweltinformationen“ (S. 438). Magnetfelder, Himmelslicht und Sterne – sicht- und spürbar in der „freien Natur“, aber nicht oder allenfalls eingeschränkt im „urbanen Raum“. Michael Beleites unterfüttert das immer wieder mit Beobachtungen und Bildern – Lesegenuss und Augenschmaus in einem. Vor allem aber belässt er es nicht bei der Kritik, sondern bietet Lösungen, die weit über das hinausgehen, was im Moment in der Gegenöffentlichkeit diskutiert wird, weil sich seine Vorschläge schlüssig aus einem großen Theoriegebäude ableiten lassen. Ich kann das hier nur mit Schlagworten andeuten. Raus aus der Stadt. Wenn das nicht auf Dauer geht, dann wenigstens so oft wie möglich. Zurück zur bäuerlichen Landwirtschaft, zurück zu dem, was den Menschen ausmacht. Körperlich arbeiten in der Natur. Heimat statt Bodenlosigkeit und damit eher Dorf als Flugzeug. Der Mensch, sagt Michael Beleites, ist gar nicht so viel anders als Tiere oder Pflanzen. Jedes Individuum spürt eine „Neigung“, im Einklang mit dem zu sein, was für die Spezies bereits da ist (S. 592). Sein Buch kündet davon, dass Michael Beleites so lebt, wie es zu ihm passt. Dann können einem irgendwelche Krakeeler auch nicht viel anhaben. *Titelbild*: Leipzig, 23. Oktober 1989. Bundesarchiv, Bild 183-1989-1023-022, Friedrich Gahlbeck (ADN) [Freie Akademie für Medien & Journalismus](https://www.freie-medienakademie.de/) [Unterstützen](https://www.freie-medienakademie.de/unterstuetzen)
@ Michael Meyen
2025-02-11 10:52:56Die Sehnsucht gar nicht so weniger Westdeutscher ist groß – besonders dann, wenn sie schon etwas älter sind und sich zu fragen beginnen, was bisher gefehlt hat in ihrem Leben. Die Antwort kann man zum Beispiel im *Kontrafunk* hören: „Plötzlich bewegt sich was“ stand dort über der letzten [Sonntagsrunde](https://kontrafunk.radio/de/sendung-nachhoeren/politik-und-zeitgeschehen/die-sonntagsrunde/die-sonntagsrunde-mit-burkhard-mueller-ullrich-ploetzlich-bewegt-sich-was#id-article). Eine Revolution, vielleicht doch noch. 1848, 1919, WIR. Und 1989, okay. Man muss nur ein wenig Markus Vahlefeld lauschen, Prototyp des konservativen Intellektuellen, knapp 60 inzwischen, um zu verstehen, wie tief dieser Stachel sitzt. Die im Osten – die haben uns etwas voraus. Die waren mittendrin, als sich die Welt zu drehen begann. Lasst uns also alles dafür tun, damit das nicht so bleibt bis in alle Ewigkeit. Wer zu den Wurzeln dieser Sehnsucht will, sollte die beiden Bücher lesen, die ich in dieser Kolumne schon einmal [empfohlen](https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/die-afd-spricht-englisch) habe und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Klein, eher dünn und sehr persönlich das eine, wuchtig, sachlich-kühl und mit dem Zeug zum großen Wurf das andere. Autobiografie hier, Wissenschaft dort – jeweils nicht zu verstehen ohne das, was Markus Vahlefeld und seine Leidensgenossen so schmerzlich vermissen. Die Erfahrung, dass morgen alles anders sein kann, lässt den Menschen gelassen und den Gedanken an mögliche Verluste beim Schreiben kleiner werden. 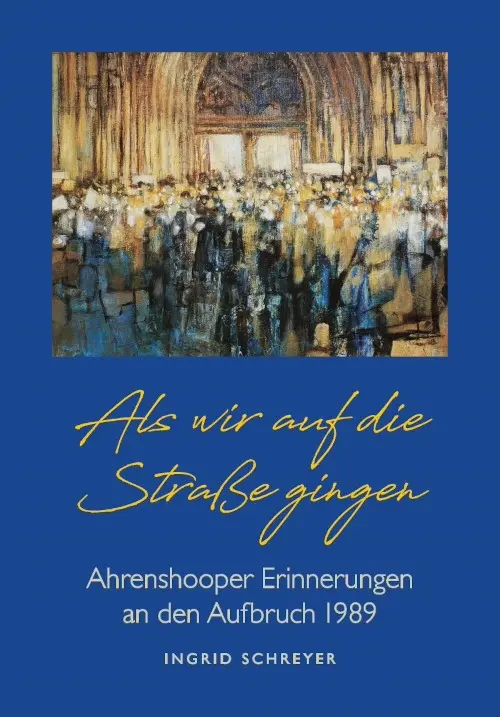 [Ingrid Schreyer](https://ingrid-schreyer.de/) hat angefangen, ihre Erinnerungen festzuhalten. Auf dem Cover geht es vordergründig um „den Aufbruch 1989“ und um Ahrenshoop, einen feinen Badeort an der Ostsee, in dem Büchlein steckt aber viel mehr – und das nicht nur, weil die Autorin mit Wolfgang Schreyer verheiratet war, einem Schriftsteller mit Millionenpublikum, deutlich älter als sie und auf der Höhe seines Schaffens auch attraktiv für eine Frau wie Brigitte Reimann, wie man in einem wunderbaren [Briefwechsel](http://okapi-verlag.de/2018/06/08/60-121/) nachlesen kann. Wolfgang, dieser Erfolgsmensch, ist natürlich noch präsent im Gedächtnis von Ingrid Schreyer. Die gemeinsamen Bücher in den 1980ern und eine Lesung in Leipzig, die Gespräche mit Stefan Heym in Strandnähe und der 9. November 1989, als Ingrid, gerade 45, unbedingt nach Berlin will, aber weder ihren Mann noch Sohn Paul, damals erst 12 und inzwischen Mitherausgeber von *Multipolar*, überzeugen kann. Das Ende der Mauer vor dem Fernsehapparat und nicht dort, wo gerade ein Weltreich zusammenbricht. So viel Rotwein steht in keinem Keller. „Wie wir auf die Straße gingen“: Dieser Titel spielt zunächst auf das an, was da hoch im Norden des Landes passiert ist, fernab der Metropolen, über die heute jeder Geschichtslehrer spricht. Der 9. Oktober in Leipzig, der 4. November in Berlin. Wie war das in Ribnitz-Damgarten und in Ahrenshoop? Wie ist Ingrid Schreyer dazu gekommen, in einem Dorf hunderte Unterschriften für das Neue Forum zu sammeln, dann eine Ortsgruppe zu gründen und die Gästehäuser der Stasi zu enttarnen? Die Antworten führen in ein christliches Elternhaus in Magdeburg, zu einem Urgroßvater, der in der Stadt als Uhrmacher und Optiker genauso eine Nummer wurde wie 1848 in der Opposition, und in ein Milieu, für das die DDR so selbstverständlich war, dass man sich nicht viel dabei dachte, kurz nach Ulbrichts Kahlschlag von 1965 einen Klub mit dem Namen „Die Andersdenkenden“ zu gründen und dort mit Beat und Joints über Gott und die Welt zu streiten, ganz ohne Angst vor Spitzeln. Auch diese Autobiografie lebt ein wenig von den Namen, die Ingrid Schreyer immer wieder einstreut, sie erzählt aber zugleich eine ganz eigene DDR-Geschichte, die, so verspricht es der Buchrücken, fortgesetzt werden soll. Den ersten Band der „Ahrenshooper Erinnerungen“ gibt es genau wie Ingrid Schreyers Bücher über die Kunst in Ahrenshoop nur bei ihr selbst, zu ordern über die [Webseite](https://ingrid-schreyer.de/bucher/). 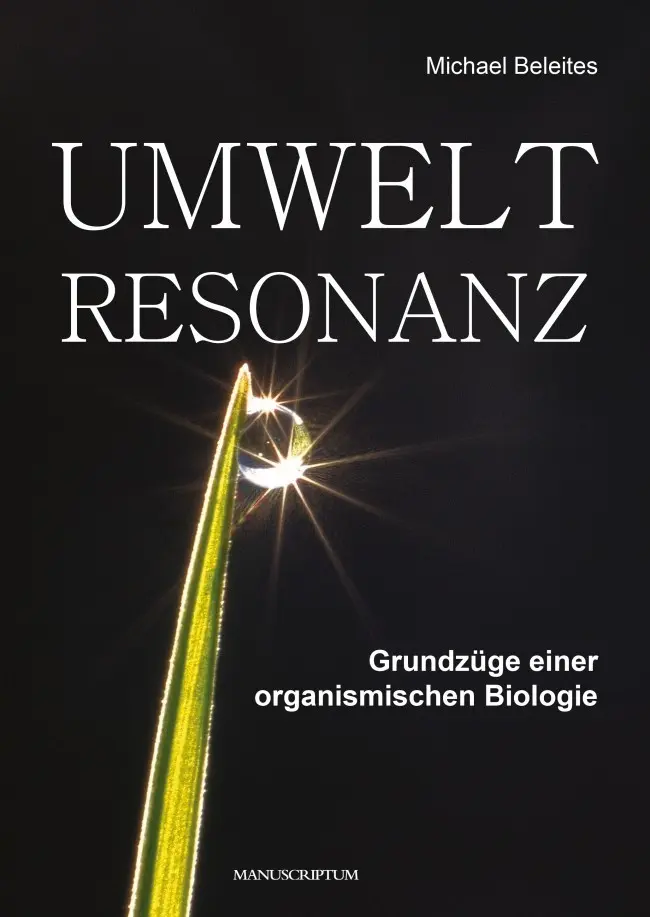 Das Buch von [Michael Beleites](http://www.michael-beleites.de/) hat schon einen Verlagswechsel hinter sich und ist trotzdem noch nicht wirklich angekommen in der Öffentlichkeit. Man könnte sagen: ein dicker Brocken, okay. Wer liest schon knapp 700 Seiten, wenn Titel und Untertitel eher schwere Kost versprechen? Das ist hier aber nicht der Punkt. Dieses Buch hat das Zeug, erst Klarheit in den Köpfen zu schaffen und dann die Welt zu verändern. Eine Revolution – aber ganz anders, als sich das die Sonntagsrunde im *Kontrafunk* gerade ausgemalt hat. Michael Beleites rüttelt an den Grundfesten unseres Denkens. Charles Darwin. Kleiner wird es nicht. Die Selektionshypothese, sagt Michael Beleites, ist widerlegt und damit alles, was mit dem Motto „Survival of the Fittest“ über uns gekommen ist. Der ewige Kampf ums Dasein. Das Wettrennen der Egoisten und damit Kapitalismus. Eine „Machbarkeits-Ideologie“, die glaubt, die Natur „zum Wohle des Menschen“ manipulieren zu können, und so Pate stand bei den Völkermorden der Nationalsozialisten. Neben Darwin räumt dieser Michael Beleites auch die Lehre von der „Vererbung erworbener Eigenschaften“ ab, einen Gegenspieler der Selektionstheorie, und damit den „biologistischen Unterbau“ der „sowjet-kommunistischen Stalin-Diktatur“, die auf „Züchtung durch Erziehung“ gesetzt habe (S. 583). Der lange Atem des Darwinismus reicht dabei weit über die Politik hinaus – von einem Artenschutz, der nicht verstehen will, dass der Lebensraum zur Art gehört, über die „Illusion“ Permakultur (S. 518) bis zum Ausblenden der „geographischen Rassenvielfalt“ als „biologische Tatsache“ und „unschätzbares Naturerbe der Menschheit“ (S. 530). Ich gebe zu: Das ist viel auf einmal. So viel und so grundlegend, dass es fast schon verwunderlich wäre, wenn der Autor keine Angriffe erlebt hätte. Ich bin auf Michael Beleites in einem Buch von [Claus M. Wolfschlag](https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/202997/meinung-pranger-konsequenzen?number=9783949041143) gestoßen. Eine Sammlung von zwei Dutzend Prangergeschichten, die ich im Sommer 2024 eigentlich rezensieren wollte, weil sie das auf sehr persönliche Weise ergänzen, was ich gerade selbst eher abstrakt als [Cancel Culture](https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/cancel-culture-zum-horen) beschrieben hatte. Im Garten schien die Sonne, aber mir war trotzdem zum Heulen. Keine Spur von Schreiblust. Das Beleites-Interview setzte allem die Krone auf. Da sprach ein Mann, dessen Namen ich aus der Geschichte des Umbruchs kannte, als Stasi-Opfer und als sächsischen Beauftragten für das Erbe des DDR-Geheimdienstes, über die ungeheuerlichen Dinge, die ihm in der Bundesrepublik der 2010er Jahre widerfahren waren, weil er mit den falschen Leuten gesprochen hat. Weil er prinzipiell mit allen redet. Weil die falschen Leute seine Ideen spannend fanden. Weil diese Ideen an der falschen Stelle erschienen waren. Pegida, Höcke, Schnellroda. Ich kann diese Rufmordgeschichte hier nur andeuten, weiß aber noch, wie ich in meinem Lesestuhl förmlich erdrückt worden bin von der Lawine, die da über Michael Beleites hereingebrochen ist. Ausladungen. Die üblichen Schlagworte: Rassismus, Antisemitismus, Nazi. Eine [Attacke](https://www.spiegel.de/spiegel/warum-ddr-buergerrechtler-sich-bei-der-afd-engagieren-a-1186288.html) im *Spiegel*. Boykott der Blumen und Kräuter, die Beleites und seine Frau in ihrem Gartenbetrieb wachsen lassen. Antifa-Attacken auf den Wochenmarktstand in der Dresdner Neustadt. Keine Chance mehr für ihre Kräutertees in den Bioläden der Stadt. In einem Wort: Existenzvernichtung wegen eines Gesinnungsverdachts, ohne dass jemand hören wollte, was dieser Autor eigentlich zu sagen hat und wie er darauf kommt. Michael Beleites ist ein Kind vom Land. Er hat schon als kleiner Junge Vögel fotografiert – an der Abbruchkante eines stillgelegten Braunkohletagebaus. Er schwärmt am Ende seines Buches von den Menschen, die ihm geholfen haben, Vogelstimmen zu unterscheiden und zu spüren, wie sich Landschaft und Tierwelt bedingen. Wie Ingrid Schreyer wächst Michael Beleites in einem christlichen Umfeld auf. Der Sohn eines evangelischen Pfarrers darf zwar kein Abitur machen und damit auch nicht Biologie studieren, wird aber Präparator, arbeitet erst in einem Naturkundemuseum und dann freiberuflich. Wir sind immer noch in der DDR, wo Beleites 1988 eine Dokumentation über den Uranbergbau veröffentlicht – seine Eintrittskarte in die Politik der dann plötzlich vergrößerten Bundesrepublik, die ihn zwar ebenfalls nicht Biologie studieren lässt, aber seinen Göttern näherbringt – Otto Kleinschmidt vor allem, einem Ornithologen, der im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein „revolutionäres Konzept zur biologischen Variation“ entwickelt, aber weitgehend vergessen wird, weil er „der allgemein anerkannten Lehrmeinung“ widerspricht (S. 15). Darwin und sonst nichts, damals schon. Wer bis hierher durchgehalten hat, versteht hoffentlich meine Bewunderung für ein Werk, das jenseits der üblichen akademischen Pfade und ohne die Sicherheit gewachsen ist, die eine Position in Universitäten oder Forschungsinstituten bietet, und trotzdem ganz genau weiß, mit was und mit wem es sich da anlegt. Michael Beleites kennt Literatur und Gegenargumente. Auch deshalb kann er es nicht unter 700 Seiten machen. Vor allem aber kennt dieser Autor seinen Gegenstand. Michael Beleites hat tausendfach gesehen, dass es in der Natur nicht um Konkurrenz geht, sondern um Zusammenhalt und Harmonie. Er sagt: Die Natur züchtet nicht. Wenn sich Arten verändern, dann im Ganzen. Anders formuliert: Die Merkmale verschieben sich zeitgleich, weil die Dinge zusammenhängen und Kräften unterliegen, die wir zwar benennen, aber schlecht messen oder gar im Experiment nachweisen können. Umweltresonanz (der Begriff, der auf dem Cover steht und zugleich Programm ist für eine nachmaterialistische Naturwissenschaft) steht bei ihm auch für den Zugriff auf die Art-„Programme“, die Gestalt und Verhalten steuern (S. 437), sowie auf die „jeweils verfügbaren natürlichen Umweltinformationen“ (S. 438). Magnetfelder, Himmelslicht und Sterne – sicht- und spürbar in der „freien Natur“, aber nicht oder allenfalls eingeschränkt im „urbanen Raum“. Michael Beleites unterfüttert das immer wieder mit Beobachtungen und Bildern – Lesegenuss und Augenschmaus in einem. Vor allem aber belässt er es nicht bei der Kritik, sondern bietet Lösungen, die weit über das hinausgehen, was im Moment in der Gegenöffentlichkeit diskutiert wird, weil sich seine Vorschläge schlüssig aus einem großen Theoriegebäude ableiten lassen. Ich kann das hier nur mit Schlagworten andeuten. Raus aus der Stadt. Wenn das nicht auf Dauer geht, dann wenigstens so oft wie möglich. Zurück zur bäuerlichen Landwirtschaft, zurück zu dem, was den Menschen ausmacht. Körperlich arbeiten in der Natur. Heimat statt Bodenlosigkeit und damit eher Dorf als Flugzeug. Der Mensch, sagt Michael Beleites, ist gar nicht so viel anders als Tiere oder Pflanzen. Jedes Individuum spürt eine „Neigung“, im Einklang mit dem zu sein, was für die Spezies bereits da ist (S. 592). Sein Buch kündet davon, dass Michael Beleites so lebt, wie es zu ihm passt. Dann können einem irgendwelche Krakeeler auch nicht viel anhaben. *Titelbild*: Leipzig, 23. Oktober 1989. Bundesarchiv, Bild 183-1989-1023-022, Friedrich Gahlbeck (ADN) [Freie Akademie für Medien & Journalismus](https://www.freie-medienakademie.de/) [Unterstützen](https://www.freie-medienakademie.de/unterstuetzen)